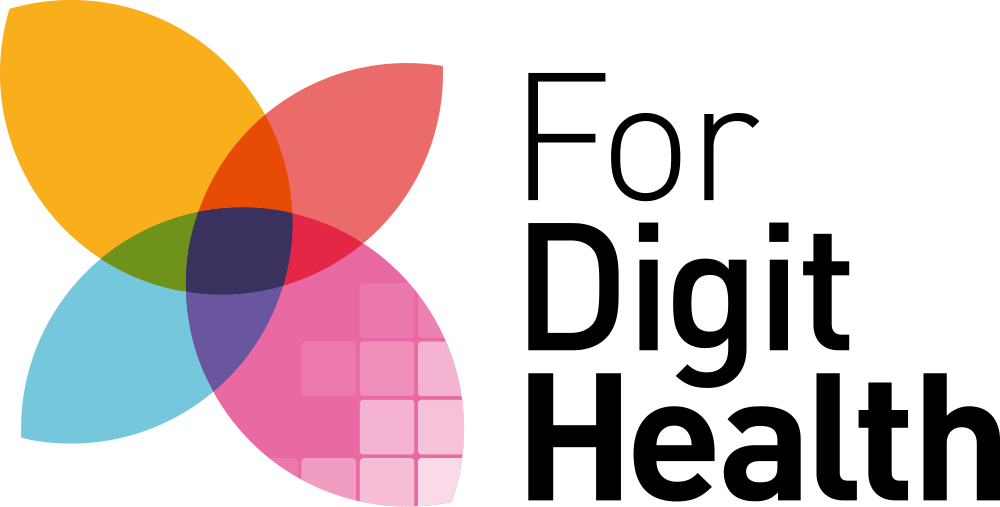Was ist digitaler Stress?
Durch die Digitalisierung des Arbeits- und Privatlebens hat der Umgang mit digitalem Stress in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Neben der Erforschung von Ursachen, Folgen und Bewältigungsstrategien, ist das Konzept von „digitalem Stress“ jedoch selbst bisher nur in den eigenen disziplinären Grenzen behandelt worden, obwohl die grundlegenden Ansätze häufig auf ähnlichen Theoriekonzeptionen beruhen und die Ergebnisse über die eigene Fachrichtung hinaus anschlussfähig sind. Das Querschnittsthema Q1 im Forschungsverbund ForDigitHealth möchte dies ändern und setzt hierzu Impulse für eine inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Forschungsrichtungen, um innovative Erkenntnisgewinne zu fördern, sowie Forschungslücken zu schließen.
Digitaler Stress – ein allgemeines Arbeitskonzept
Im Forschungsverbund wird das Phänomen „digitaler Stress“ aus einer Vielzahl verschiedener Stresstheorien betrachtet, welche sich jeweils auf einen Teilaspekt des Stressprozesses fokussieren und sich in drei Bereich einteilen lassen: in die Psychologie, die Wirtschaftsinformatik und Sozialwissenschaften/Informatik/Medizin. Bevor diese Konzepte in ihren Spezifika genauer erörtert werden, ist es zunächst wichtig ein generelles Verständnis von digitalem Stress vorzulegen. Hierzu dient das folgende „Arbeitskonzept“:
Digitaler Stress ist Stress im Kontext von digitalen Technologien und Medien (DTM). Das heißt, dass digitaler Stress ein Prozess ist, in dem ein Individuum die Anforderungen aus dem Umgang mit digitalen Technologien und Medien ins Verhältnis zu den eigenen verfügbaren Ressourcen setzt. Übersteigen die Anforderungen die Ressourcen, kann eine Stressreaktion entstehen. Diese Stressreaktion selbst kann physiologisch, emotional, kognitiv und verhaltensbezogene Bestandteile haben und dabei sowohl kurzfristige Folgen für das Verhalten wie auch Langzeitfolgen, z.B. in Bezug auf die Gesundheit implizieren. Der Einfluss von digitalem Stress auf Körper und Psyche kann durch subjektive Selbstauskunft, Fremdbeobachtungen oder physiologische Biomarker, gemessen werden.
Digitaler Stress als Prozess kann bewusst oder unbewusst ablaufen – dies hängt ganz von den jeweiligen Anforderungen ab. Diese Anforderungen können entweder direkt oder indirekt sein und aus dem individuellen Umgang mit DTM resultieren oder aus dem Umgang des Umfelds mit DTM. Die verfügbaren (kognitiven) Ressourcen des Individuums, die zur Bewältigung von digitalem Stress nötig sind, schließen spezifische Kompetenzen, wie beispielsweise auch die eigene Medienkompetenz mit ein.
Welche Anforderungen konkret als stressig wahrgenommen und ob diese positiv (Eustress) oder negativ (Distress) bewertet werden, ist subjektiv je nach Situation, Kontext und Nutzer*innen (z. B. KI, Kommunikationslast, Alter) unterschiedlich. Oftmals schreiben digital gestresste Personen diesen als belastend wahrgenommenen Technikanforderungen, bestimmte Medienpraktiken und Nutzungskontexte zu.
Digitaler Stress – ein facettenreiches Theorem
Je nach Disziplin wird mit unterschiedlichen Stresstheorien gearbeitet. Betrachtet man alle Theorien zusammen ergibt sich eine komplexe Beschreibung von „digitalem Stress“, die durch die spezifische Betrachtungsweise ihres jeweiligen Teilaspekts zu einem ganzheitlichen Verständnis des Phänomens beitragen kann.
Viele Stresstheorien stammen aus der Psychologie von Vorreitern, wie Selye (1953), Lazarus (1984) und Folkman (1984) und prägten mit ihrer Relevanz die heutige Forschung. Diese Theorien beschäftigen sich mit Stress im Allgemeinen und lassen sich nicht nur auf das Forschungsfeld des digitalen Stress anwenden. Sie liefern uns Ansätze und Theorien, die individuellen Unterschiede in der Wahrnehmung solcher Stresssituationen zwischen einzelnen Personen zu erklären und bilden die theoretische Basis für viele Studien, die sich mit dem Umgang und der Bewältigung von digitalem Stress beschäftigen. Das „transaktionale Stressmodell“ (TASM) ist eine der relevantesten psychologischen Stresstheorien und wurde von Lazarus (1984) formuliert. In diesem Modell liegt der Fokus auf der individuellen Wahrnehmung der umgebenden Anforderungen und der subjektiven Kompetenzen mit diesen umzugehen. Beurteilt eine Person die Situation demnach als herausfordernd und schätzt die eigenen Fähigkeiten in Bezug auf diese eher gering ein, dann entsteht Stress. Diese individuelle Bewertung kann unterschiedliche Reaktionen von verschiedenen Personen auf identische Situationen erklären. Zum Beispiel hängt die Bewertung von der Wichtigkeit und Relevanz der Situation ab, sowie dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mit der Situation umgehen zu können.
Einen weiteren Bereich stellen Theorien aus der Wirtschaftsinformatik dar, die teilweise an Theorien aus der Psychologie anschließen und sich auf die technologischen Folgen der Entwicklung, besonders für das arbeitende Individuum, fokussieren. Hier ist häufig von Technostress die Rede. Sie identifizieren beispielsweise Belastungsfaktoren des Umgangs mit digitalen Technologien und Medien, die der Auslöser von digitalem Stress sein können. Dazu gehört zum Beispiel die Entgrenzung zwischen Beruf und Privatleben durch ständige Erreichbarkeit, oder die Überlastung durch eine Vielzahl digitaler Nachrichten. Dabei basiert die wirtschaftsinformatische Stresstheorie auf dem vom Psychologen Craig Brod formulierten „Technostress-Modell“, das er bereits in den 80er Jahren beschrieb. Es bezeichnet Situationen, in denen sich Mitarbeiter*innen nicht an moderne Bürotechnik anpassen können, was zu Belastung führt. Im Laufe der Zeit wurde die Theorie im Hinblick auf die digitalen Technologien und Medien erweitert und aktualisiert. Zugrunde liegt der Theorie der Stimulus-Response-Mechanismus: also die Annahme, dass es Aspekte der Technik gibt (wie z.B. deren Omnipräsenz), die bei Nutzenden Stress auslösen können.
Die Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Medizin betrachten das Phänomen des digitalen Stress aus einer gesellschaftlichen Mikro- wie Makro-Perspektive und schärfen den Blick für die spezifischen Entstehungskontexte und sozialen Praktiken im Umgang mit digitalem Stress, aber auch für die gesellschaftliche Wahrnehmung von digitalem Stress insbesondere im Rahmen medialer Berichterstattung und von öffentlichen Diskursen. Hier finden sich sowohl Zeitdiagnosen und Gesellschaftsbeschreibungen, die auf der Makroebene Wandlungsprozesse erklären, als auch mikrotheoretische Ansätze wie beispielsweise die biochemischen Reaktionen des Menschen als Organismus auf Stressoren. Ein makrogesellschaftlicher Ansatz ist beispielsweise die Mediatisierungstheorie nach Hepp (2013), die mit dem Prozess der Mediatisierung quantitative wie qualitative Veränderungen der verschiedenen kulturellen und sozialen Kontexte, wie z. B. die alltägliche Lebenswelt der Menschen, in denen (digitale) Technologien und Medien eingebettet sind, beschreibt. Dabei wird den digitalen Medien eine gewisse Prägkraft zugeschrieben, die nicht auf „direkte Wirkungen“ reduzierbar ist. So kommt der Mediatisierungsansatz zu dem Schluss, dass Alltag und Medienalltag, Sozialisation und Mediensozialisation oder auch digitaler und analoger Stress analytisch kaum mehr trennbar erscheinen.
Ergänzend zu den drei Bereichen ist es im Bereich der Biologie und Medizin möglich auch die psychischen und körperlichen Auswirkungen, wie ein akuter Anstieg des Cortisolspiegels oder langfristige chronische Auswirkungen, zu denen zum Beispiel Entzündungen im Körper zählen, zu messen.
Ist digitaler Stress im Alltag nun ein einheitliches Konzept?
Nein, das ist lässt sich nicht eindeutig sagen. Wie die Ergebnisse des Teilprojekts C06 zeigen, lässt sich kein übergeordnetes Konzept von digitalem Stress im Alltag ausmachen. Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 35 Jahre wurden dazu befragt, welche Formen von digitalem Stress sie in ihrer Freizeit erfahren und wie sie diese gewichten. Damit wurde zugleich eine Forschungslücke geschlossen, da in vorangegangenen Studien Proband*innen in der Regel nur den Grad der Zustimmung zu einer bestimmten Aussage angeben konnten, nicht aber, ob sie von dieser Aussage überhaupt betroffen sind – und falls sie es sind, wie oft sie sich damit konfrontiert sehen.
Die Studienteilnehmer*innen des Teilprojekts C06 wurden befragt, welche Faktoren bei der Nutzung von digitalen Technologien und Medien sie stresst. Der Studie liegt das „transaktionale Stressmodell“ nach Lazarus zugrunde. Abgefragt wurden zwölf Stressoren, also potentiell stressauslösende Situationen, die vorher von den Projektleiter*innen festgelegt wurden. Darunter befanden sich Faktoren wie Cyberbullying, Approval Anxiety, Techno-Overload, die Digital Invasion sozialer Interaktionen. Letzteres meint, dass beim Treffen mit Freunden oder Familie digitale Technologien und Medien die Konversation beherrschen oder beim Zusammensein diese intensiv genutzt werden, so dass ein analoger sozialer Austausch verhindert wird. Aber auch Faktoren wie Nutzungs- und Kompetenzvergleiche, was den Umgang mit digitalen Technologien angeht wurden abgefragt sowie die Beherrschung des Alltags durch digitale Technologien und Medien, also die ständige praktische Konfrontation oder mentale Auseinandersetzung mit diesen, so dass ein Abschalten wortwörtlich kaum mehr möglich ist.
Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass von den 12 erfassten Stressoren nur sieben für digitalen Stress im Alltag relevant sind. Besonders auffällig war in diesem Teil der Auswertung, dass ein Techno-Overload von den 18 – bis 35-Jährigen in ihrer Freizeit nicht als Stressor wahrgenommen wird – anders als in Studien zu digitalem Stress am Arbeitsplatz herausgefunden, wo dieser durchaus einen relevanten Stressauslöser darstellt. Zum anderen unterschieden sich die Stressoren in ihrer Häufigkeit und Intensität: So waren beispielsweise nur wenige der Befragten von Cyberbullying betroffen, aber fast alle von der Digital Invasion. Jedoch wurde ersteres als deutlich stressvoller beurteilt als letzteres. Die ermittelten sieben Stressoren wurden anschließend statistisch ausgewertet, um herauszufinden, ob es einen besonders prominenten Stressor gibt, welcher der Ausgangspunkt für ein einheitliches Konzept von digitalem Stress darstellen würde. Dies war jedoch nicht der Fall.
Die Wissenschaftler*innen konnten zwar feststellen, dass die einzelnen abgefragten Stresssituationen korrelieren, dass es aber keinen subsummierenden Stressor gibt und somit auch kein einheitliches Konzept von digitalem Stress. Doch warum ist das so wichtig?
Digitaler Stress – ein subjektives Konzept
Relevant sind die Ergebnisse der Studie vor allem für den Gebrauch des Begriffs „Digitaler Stress“ in Medien und Forschung. Es scheint nicht das eine Konzept von digitalem Stress zu geben, sondern dieser konstruiert sich für jeden Betroffenen anders und in Abhängigkeit subjektiver Faktoren, wie persönlicher Einstellungen, der eigenen und der individuellen Möglichkeit zur Stressbewältigung. Daher sollte gerade in der medialen Berichterstattung Abstand davon genommen werden, verallgemeinernd von digitalem Stress zu sprechen, sondern stattdessen das spezifische Phänomen konkret zu benennen. Für die Forschung ergibt sich aus den Studienergebnissen dieses Teilprojekts, dass es möglich und sinnvoll ist, einzelne Stressoren auszumachen und diese separat zu erforschen, so dass langfristig Ergebnisse bereitgestellt werden können, die es den Betroffenen ermöglichen ein für sie passendes und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Lösungssystem zur individuellen Stressbewältigung im Alltag zu finden. So könnte auch gezielter als bisher ermittelt werden, welche jeweiligen Kompetenzen und Einstellungen für einen funktionaleren Umgang mit den einzelnen digitalen Stressoren geschult werden können.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Digitalem Stress scheint kein einheitliches Konzept zu sein, sondern eine Ansammlung unabhängig voneinander auftretender Phänomene. Wenn wir von „digitalem Stress“ sprechen, beziehen wir uns auf einen Sammelbegriff – das muss uns bewusstwerden.
- Eine spezifische Erforschung der einzelnen Stressoren ist sinnvoll, um den Betroffenen individuell einen funktionaleren Umgang mit ihnen zu ermöglichen.
- Die Diversität von digitalem Stress in Forschung und medialer Berichterstattung zu berücksichtigen, trägt dazu bei, den Betroffenen gezielter helfen zu können.
Autorinnen: Theresa Aumüller/Jasmin Rother
In der Studie „PräDiTec“ wurden Digitaler Stress und Belastungsfaktoren der digitalen Arbeit bereits vor ForDigitHealth untersucht. Sie haben sowohl eine Infografik zu diesen Themen als auch eine beispielhafte Darstellung der Faktoren für digitalen Stress verfasst, die wir zum Weiterlesen empfehlen können.