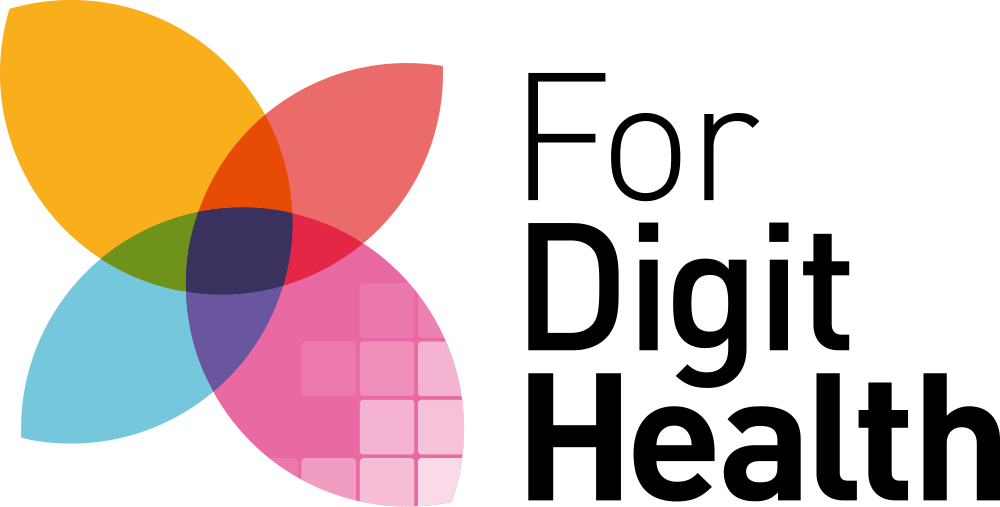Auf welche Art und Weise beeinflussen existierende Apps und Technologien die Gesundheit der Anwender*innen?
In den letzten Jahren haben sich Apps zu einem immanenten Bestandteil unseres Alltags entwickelt. Von Fitnessarmbändern bis hin zu Trackingapps zur Überwachung von Schlaf und Stress gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, die uns dabei helfen sollen, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu verbessern. Inwiefern bereits existierende Apps und Technologien unsere Gesundheit beeinflussen erforscht das Teilprojekt D10. Die Ergebnisse der Analysen zielen darauf ab die menschenzentrierte Entwicklung von digitalen Technologien stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit von Entwickler*innen zu stellen.
Positiver Einfluss auf die Gesundheit
Eine der offensichtlichsten Auswirkungen von bereits existierenden Apps und Technologien, besonders Gesundheitsapps, ist es, dass sie Benutzer*innen die Möglichkeit der Überwachung und Verbesserung ihrer körperlichen Gesundheit geben. Apps zur Überwachung von Aktivitäten und Schlaf können den Benutzer*innen helfen, ein besseres Verständnis für ihre Gewohnheiten zu entwickeln und gesündere Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel können Fitnesstracker dazu beitragen, dass Menschen sich regelmäßig bewegen, was wiederum dazu beiträgt, Übergewicht und damit verbundene Gesundheitsprobleme zu reduzieren. Hinzu kommt, dass Gamification-Elemente, also spielerische Elemente, die mit der Appnutzung verbunden sind, einen motivierenden Einfluss auf Nutzer*innen ausüben können, um eine langfristige Verhaltensänderung anzustreben.
Darüber hinaus können (Gesundheits-)Apps das Selbstmanagement der Nutzer*innen unterstützen, gerade im Hinblick auf chronische Krankheiten, wie Diabetes. Zum Beispiel können Apps zur Blutzuckerüberwachung Diabetiker*innen dabei helfen, ihren Blutzuckerspiegel zu überwachen und sicherzustellen, dass sie ihre Insulindosis entsprechend anpassen. Wiederum bieten gerade Gesundheitsapps, die in enger Kooperation mit medizinischem Fachpersonal entwickelt wurden, die Möglichkeit mehr Zugang zu Informationen und Ressourcen über die eigene Krankheit bereitzustellen.
Neben der körperlichen Gesundheit können Gesundheitsapps auch zur Verbesserung der psychischen Gesundheit beitragen. Es gibt Apps, die sich auf Meditation und Stressbewältigung konzentrieren, sowie solche, die Online-Therapie und -Beratung anbieten, um psychische Gesundheitsprobleme anzugehen. Sie ersetzen jedoch keine Therapie, sondern sind nur als Ergänzung anzusehen.
Negative Auswirkungen auf die Gesundheit
Trotz der Vorteile, die (Gesundheits-)Apps und -Technologien bieten, gibt es auch einige Herausforderungen und negative Aspekte, die bei der Nutzung von Apps berücksichtigt werden müssen. So kann der ständige Einsatz von Apps und Technologien zu Abhängigkeiten führen, die sich negativ sowohl auf die körperliche als auch auf die psychische Gesundheit auswirken können. Als Beispiel wäre das ständige Streben nach Selbstoptimierung mithilfe von Gesundheitsapps, durch andauernde Überwachung und Analyse, zu nennen, welches sich negativ auf das eigene Wohlbefinden auswirken kann. Statt Stress zu reduzieren, wird hierdurch Stress verursacht, indem der Körper und das eigene Selbst unter Leistungsdruck geraten.
Ein weiteres Problem ist, dass nicht alle (Gesundheits-)Apps und Technologien auf dem Markt geprüft sind. Viele dieser Anwendungen sind nicht von Fachleuten validiert und können daher möglicherweise ungenaue oder sogar gefährliche Informationen bereitstellen. Daneben sollte beachtet werden, dass besonders Gesundheitsapps viele persönliche Daten ihrer Nutzer*innen sammeln und verwalten. Hier sollte bei der Entscheidung für eine spezifische App immer die Datensicherheit mitbedacht werden.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Gesundheitsapps sind durch das Tracking unserer Körperfunktionen in der Lage unser Wohlbefinden zu verbessern.
- Dennoch können sie zu einem ungesunden Abhängigkeitsverhältnis beitragen, wenn das Streben nach Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit in den Selbstoptimierungswahn führt.
- Darüber hinaus sind nicht alle auf dem Markt befindlichen Gesundheitsapps von Fachleuten geprüft und könnten daher Mängel im Datenschutz aufweisen oder gefährliche Informationen bereitstellen
Autorin: Jasmin Rother